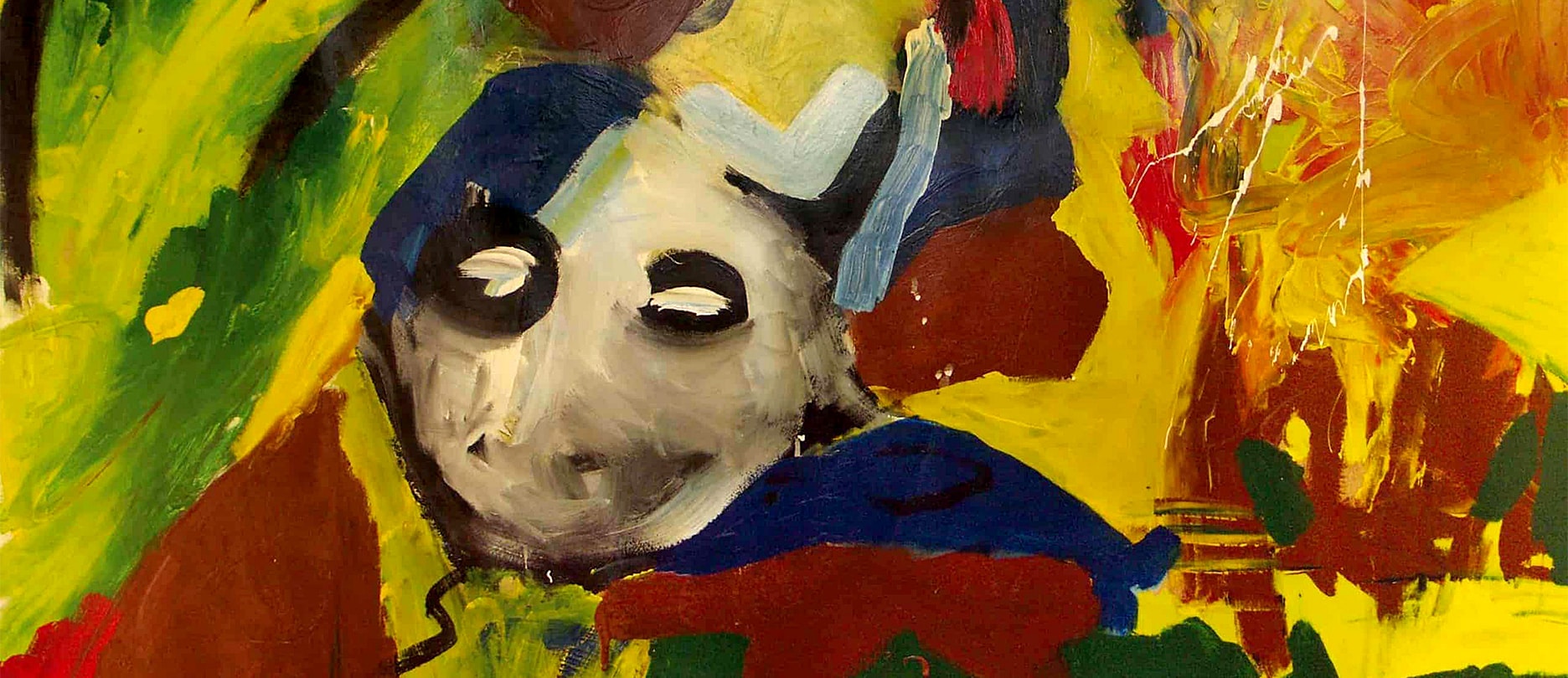Interview mit Marit Matten, therapeutische Leitung und Sarah Gerstl, Leitung der Außenstelle Augsburg
Der Stress kommt bei Geflüchteten oft in Deutschland erst richtig an: Die sogenannten Postmigrationsstressoren reichen von Unterbringung ohne Privatsphäre über eingeschränkte Gesundheitsversorgung bis hin zu Diskriminierungserfahrungen. Psychotherapeutin Marit Matten und die Leitung unserer Außenstelle in Landshut Sarah Gerstl erläutern im Gespräch die Auswirkungen dieser Belastungsfaktoren auf unsere Klient*innen.
Marit, was sind sogenannte Postmigrationsstressoren und wie wirken sie sich auf unsere Klient*innen aus?
Marit: Darunter verstehen wir alle Belastungsfaktoren, die Geflüchtete hier in Deutschland, also nach ihrer Flucht, erleben. Das können schlechte Bedingungen in den Unterkünften sein, zum Beispiel, weil sie in einem kleinen Mehrbettzimmer mit fremden Personen schlafen müssen. Das kann auch eine schlechte Gesundheitsversorgung sein, weil während des Asylverfahrens nur eine medizinische Akut-Behandlung möglich ist. Das langwierige und komplexe Asylverfahren ist auch für viele sehr belastend. Dazu kommt, dass sie hier leider häufig mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert sind. Unsere Klient*innen sind mehrfach traumatisierte Menschen mit einer schweren Symptomatik und dieser zusätzliche Stress führt in vielen Fällen zu einer Verschlechterung ihrer Erkrankung.
Sarah, in der sozialen Beratung seid ihr mit den Problemen der Klient*innen beschäftigt, die eben diesen Stress verursachen. Welche Themen habt ihr da?
Sarah: Viele sind angespannt aufgrund ihrer unsicheren Bleibeperspektive und den Debatten um Abschiebungen. Einige können aufgrund ihres Status keinen kostenlosen Deutschkurs besuchen oder nicht arbeiten. Diese Menschen werden zur Passivität verdammt und können sich nicht sinnvoll beschäftigen. Oder wenn zum Beispiel die Ausländerbehörde eine Geburtsurkunde verlangt, die aber einfach nicht existiert und auch im Herkunftsland nicht zu besorgen ist. Das führt dann zu Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Diese Belastungen gelten ja für alle Asylsuchenden, was bedeuten sie insbesondere für unsere Klient*innen?
Marit: Mit einer psychischen Erkrankung oder Traumafolgestörungen ist schon der normale Alltag oft schwierig. Menschen mit einer Depression zum Beispiel sind oft antriebslos, Geflüchtete mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung können extrem ängstlich sein oder haben Flashbacks, die sie plötzlich aus der Gegenwart reißen. Diese Probleme kosten so viel Energie, dass keine Kraft mehr bleibt, sich im System zurecht zu finden oder Hilfe zu finden. Das führt dann oft durch Resignation und Hoffnungslosigkeit in einen Teufelskreis.

Man könnte vermuten, dass die Erfahrungen vor und während der Flucht viel schwerwiegender waren. Viele waren selbst in Lebensgefahr oder haben andere sterben sehen.
Marit: Das stimmt, aber die Leute kommen mit einem riesigen Rucksack voller traumatischer Ereignisse hier an und der Akku ist total leer. Dann sind die ganzen genannten Probleme einfach zu viel. Man weiß aus der Forschung, dass es bei einer Traumatisierung sehr wichtig ist, wie die Person danach versorgt ist. Wenn sie nicht gut untergebracht ist und sich nicht sicher fühlt, verstärken sich die Symptome. Eine Patientin hat mal zu mir gesagt, sie würde gerne nicht als Kranke zu uns kommen, weil es eigentlich nicht sie ist, die falsch ist, sondern die äußeren Umstände.
Was könnt ihr tun, um den Stress zu mildern?
Sarah: In Alltagsfragen versuchen wir mit den Klient*innen Lösungen zu finden, damit sie selbst handeln können. Ich hatte mal eine Klientin, die konnte nicht lesen, wusste aber Papier ist in Deutschland total wichtig. Dann haben wir daran gearbeitet, dass sie optisch erkennen kann, woher der Brief kommt. Also wie sieht zum Beispiel das Stadtwappen aus oder der Absender vom BAMF. Dann weiß sie, was wichtig ist. Einen kostenlosen Alphabetisierungskurs hat sie von der Behörde leider nicht genehmigt bekommen, den haben wir dann über Spenden der Erzdiözese München finanziert.
Wie groß ist der Anteil solcher Themen in der Therapie?
Marit: Wir haben den Vorteil, dass wir im Tandem mit der Sozialberatung arbeiten. Deshalb kann ich die Lösung der konkreten Probleme an die Kolleg*innen abgeben. In der Therapie geht es dann darum, wie man die Themen aushalten kann, über die Verzweiflung und Perspektivlosigkeit zu sprechen und Hoffnung zu vermitteln.
Wie vermittelt man Hoffnung?
Marit: Gute Frage. Da komme ich schon auch manchmal an meine persönlichen Grenzen. In der Therapie geht es häufig darum, gemeinsam mit den Klient*innen auszuhalten, was wir nicht sofort ändern können. Das ist aber für mich auch der schwerste Teil der Therapie.

Die Sozialberatungen müssen Probleme mit Behörden, Unterkünften, Schulen, etc. lösen. Ist da immer Verständnis vorhanden?
Sarah: Ich schildere das mal mit einem Beispiel: Eine Klientin hat vor der Einführung der Bezahlkarte ihr Geld ganz normal auf ihr Konto bekommen. Die Kleidung für ihre Kinder hat sie billig online gekauft und in Raten gezahlt. Durch die Bezahlkarte war die Möglichkeit auf einmal weg, aber die Raten waren noch offen. Die Frau hat versucht mit dem Sozialamt zu sprechen, dann mit dem Inkassounternehmen und die Mahngebühren wurden immer höher. Sie hatte das Gefühl die Probleme werden immer größer, sie wurde immer kraftloser und hilfloser. Wir konnten das dann individuell für sie lösen, aber in ihrer Therapie wurde sie durch diese gefühlte Ohnmacht erstmal wieder zurückgeworfen.
Bei solchen Dingen fehlt häufig das Verständnis, was dieser Mehraufwand für eine Kettenreaktion auslöst und die Klient*innen wieder in eine neuen Situation der Unsicherheit bringt. Wenn man das Schulessen nicht mehr bezahlen kann oder das Bargeld für die Fahrkarte im Bus fehlt, ist das purer Stress und für ohnehin belastete Menschen kann das zu viel werden.
Wie wirkt sich die aktuelle Debatte über Abschiebungen und Begrenzungen des Asylrechts auf eure Klient*innen aus?
Sarah: Vor allem Menschen mit Kindern sind belastet, die fragen sich wie das weitergehen soll, in welcher Gesellschaft ihr Kind leben wird. Viele sagen, wenn es nur um mich gehen würde… Aber für mein Kind will ich das nicht.
Und was kann jede und jeder Einzelne tun, um zu helfen?
Marit: Ich glaube es fehlt zum Teil ganz viel Wissen über die reale Situation von Geflüchteten. Es wäre gut, wenn darüber mehr Fakten verbreitet würden, das kann natürlich auch jede*r Einzelne tun.
Sarah: Das Anerkennen der Situation hilft den Menschen auch schon. Das Verstehen und Teilen der Hilflosigkeit ist oft schon viel, dann merken die Menschen, dass sie nicht allein gelassen werden und das hilft sehr.